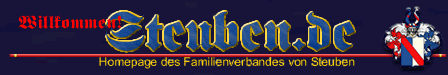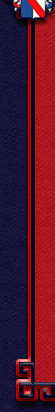|
Ich wurde am 18. August 1880 zu Frankfurt an der Oder geboren. Mein Vater Eugen
von Steuben war damals Hauptmann im Leib-Grenadier-Regiment
Nr. 8, meine Mutter Marie ist eine geborene Paschke
(† 1904), Tochter eines Rittergutsbesitzers
in Lübben (Niederlausitz). Meine Mutter ist
die zweite Frau meines Vaters. In erster Ehe,
aus der mein Stiefbruder Eugen hervor-gegangen
ist, war er mit der Schwester meiner Mutter verheiratet.
Mein Großvater väterlicherseits war
bereits 1878 als Königlicher Oberforst-meister
in Frankfurt/Oder gestorben. Seine Frau Marie,
geb. von Loeben († 1883), lebte mit ihrer
Tochter Therese († 1897) gleichfalls in
Frankfurt, während meine Großmutter
mütterlicherseits, eine geborene von Leyser
schon lange gestorben war († 1857). Von
den Geschwistern meines Vaters lebte damals außer
meiner Tante Therese nur noch ein Bruder, Königlicher
Oberförster in Falkenberg bei Torgau (†
1890), auf derselben Oberförsterei, die einst
mein Großvater gehabt hatte. Der älteste
Bruder hatte als Garde-Artillerist seinen Tod
zu Berlin gefunden.
|
Von den Geschwistern meiner
Mutter war die älteste, Anna, mit dem Generalmajor
von Trebra († 1905), und Clara, mit dem Verlagsbuchhändler
Otto Klasing in Leipzig verheiratet. Ihr Bruder Max
war Kaufmann.
Am 18. Oktober 1880 erhielt
ich in der Taufe den Namen Kurt Karl Eugen.
Anfang 1881 wurde mein
Vater in das Infanterie-Regiment Nr. 98 nach Brandenburg/Havel
versetzt und nahm mit seinem Bruder Richard und fünf
anderen Offizieren unseres Namens an der großartigen
Yorktownfeier als Gäste der Vereinigten Staaten
von Nord-Amerika teil.
Meine weitgehendste Erinnerung
ist der Besuch auf der Oberförsterei Falkenberg
(1882), wo mir ein Perlhuhn auf den Kopf flog.
1884 erfolgte durch die
Versetzung des Regiments 98 unsere Übersiedlung
nach Metz. Im Herbst 1886 kam ich zur Schule, die mir
gleich von vornherein sehr wenig zusagte und mich auch
nicht zum Liebling meines sehr tüchtigen Lehrers
Kothe machte. Einen sehr guten Kameraden und Gesinnungsgenossen
fand ich in Hugo Rossbach. Als kleine Stifte schlossen
wir uns gern den Banden älterer, etwas rauhbeiniger
Jungens an, um dann auf der Metzer Esplanade , auf der
Mosel und auf der großen Insel vor der Stadtumwallung
unser Unwesen zu treiben. So wurde ich ein fauler, unaufmerksamer
Schüler, war aber auf nichts mehr stolz als auf
die Courage, die ich mir im Klettern und Springen erworben
hatte.
In der Familie fühlte
ich mich nicht immer ganz so glücklich, denn die
Art, in der sich mein sechs Jahre älterer Bruder
entwickelt hatte, war geeignet, jedes frohe Zusammensein
der Familie zu stören. Er hatte von klein auf einen
wahren Hang zur Bosheit. So war es ihm ein ausgesprochener
Genuß, seine Mutter zu kränken und dann auf
das Verhältnis zur Stiefmutter zu pochen, um dann
bei seinem Vater nicht so ganz ohne Rückhalt zu
sein. Die zeitweise Strenge meines Vaters vermochte
gegen diese brüderliche Boshaftigkeit nichts auszurichten;
dauernd geneckt und gehänselt, wich ich meinem
Bruder meist aus. Meine größte Freude war,
wenn ich bei meinem Vater exerzieren durfte und als
kleiner Neunjähriger mit dem Mausergewehr stramme
Griffe machte, dass meine Schultern oft ganz blau
waren. In einer rührenden Weise wurden mir von
meinen Eltern fast alle Wünsche erfüllt, so
dass ich bald mit einer Unmenge von militärischem
Spielzeug unter meinen Altersgenossen so eine Art Generalsstellung
einnahm.
Ein andere großer
Anziehungspunkt war der Pferdestall. Nicht nur um beim
Füttern und Putzen der Pferde zu helfen, trieb
ich mich im Stall umher. Manchmal erklomm ich auch den
grobknochigen Staatsgaul des Vaters, um auf seiner breiten
Kruppe ein Märchenbuch zu verschlingen. Auf einem
kleinen braunen Wallach machte ich meine ersten Reitübungen
und die schönsten Tage waren es, wenn ich meinem
Vater nach Frescaty entgegenlief, um mit seinem Bataillon
zusammen zu Pferd in Metz einzurücken. Etwas was
dieses ungehinderte Genießen meiner Passionen
sehr verbitterte, war meine wenig widerstandsfähige
Gesundheit.
Einige nette Reisen unternahmen
wir damals auch. Einmal waren wir bei den Verwandten
in Leipzig, einmal in den Vogesen und bei Trebras in
Neu-Breisach. Am schönsten war es natürlich
auf der Oberförsterei in Falkenberg (1888).
Die Verhältnisse,
die durch die Eigenschaften meines Bruders hervorgerufen
wurden, spitzten sich immer mehr zu. Eugens Lebenswandel
war so, dass der Pfarrer Schwierigkeiten machte,
ihn zu konfirmieren (1889). Häufige unangenehme
Szenen trugen dazu bei, dass meine Mutter - nachdem
eine Erholungsreise an den Vierwaldstädtersee nicht
viel genützt hatte - in eine Nervenheilanstalt
nach Bonn musste (1890). Meine Tante Therese übernahm
nun den Haushalt.
Mein Bruder verschlimmerte
sich in einer Weise, dass man sich entschloß,
ihn in ein Irrenhaus zu schicken (1891), da es für
ein Korrektionshaus bereits zu spät war. Bei einigen
Gräuelszenen muss wohl auch krankhafte Veranlagung
mitgewirkt haben. Unvergeßlich ist mir die verwüstete
Stube, in der Eugen die Tante zu Boden geworfen und
zwei Lampen gegen uns geschleudert hatte, bis er schließlich
von beiden Burschen überwältigt wurde. In
solchen Fällen handelte es sich meist um eine Gelderpressung
und leider nie ohne Erfolg.
Ein kleiner Ersatz für
die fehlende Mutter in diesen Zeiten war das herzliche
Entgegenkommen seitens der Familien des Regimentes.
In erster Linie Regenauers, bei Briesens und Wunschs.
Auch in der Familie meines Schulfreundes Hans Jobst
erlebte ich schöne Stunden. Auch meiner kleinen
Freundin Martha Dombrut muss ich hier gedenken.
Im Herbst 1891 stand die
Versetzung meines Vaters bevor. Meiner Mutter ging es
so, dass sie bald zurückkehren sollte, jedoch
erst in die neue Garnison. Ich ging auch nicht erst
in das neue Schulsemester, um das wenige was ich gelernt
hatte, ganz zu verlernen.
Anfang 1892 erfolgte die
Versetzung nach Mainz, nachdem ich herrliche Zeiten
mit meiner Mutter auf dem Gut meiner Großtante
Frau von Vohs († 1896) in Pretschen im Spreewald
erlebt hatte. Zu dieser Zeit passierte es mir als einem
elfjährigen kleinen Strolch zum ersten Mal, dass
ich mein Herz verlor und zwar an das Töchterlein
eines benachbarten Gutsbesitzers.
Das Mainzer Leben unterschied
sich wenig von dem Metzer. Mein Bruder war aus der Irrenanstalt
ausgebrochen und suchte uns längere Zeit heim,
um dann nach Amerika zu gehen. Durch Mitleid erregende
Briefe erwirkte er sich jedoch schon bald die Erlaubnis
seines Vaters zurückkommen zu dürfen, um dann
Jahre lang untätig umher zu laufen.
In der Schule erlebte
ich die schmerzlichsten Enttäuschungen und gesundheitlich
ging es auch nicht glänzend, denn ich hatte viel
unter unerträglichen Schmerzen zu leiden. Sehr
netten Verkehr hatte ich durch die Familie Ludwiger
und Horst von Ludwiger kann ich wohl als den liebsten
Freund aus meiner Kindzeit bezeichnen.
Unsere Pferde standen
in der Nähe des Gau-Thores. Ich erhielt eine Erlaubniskarte
zum Betreten der Festungswerke. Dort führte ich
mit meinen Schulfreunden das reinste Soldatenleben.
Manchmal saß ich dann sehr stolz zu Roß,
um meine Soldaten zu besichtigen. Dabei turnten wir
und schossen mit Gewehren und Pistolen, dass jeder,
der uns zusah, ganz überrascht war (1893). Meine
Hauptfreunde hierbei waren Kurt Gerok und Eduard Eidenmüller.
Mit ersterem machte ich große Bleisoldatenschlachten,
für die wir in tagelanger Vorbereitung ganze Länder
bauten, um dann mit Messingkanonen die fürchterlichsten
Kanonaden zu machen. So manche Pulverwolke und Fensterscheibe
ging dabei mit Krach in die Luft. Eidenmüller war
mein Hauptgenosse in allem, was gewagte Unternehmungen
betraf. Einstmals brachen wir ein Fenstergitter einer
alten kleinen Befestigung zwischen Gau- und Binger Thor
ein und gerieten, nachdem wir eine Treppe hinabgestiegen
waren, in ein Labyrinth von unterirdischen Gängen.
Nun suchten wir uns unsere mutigsten Klassenkameraden
aus, um ausgerüstet mit Laternen, Dolchmessern
und Pistolen unterirdische Entdeckungsreisen zu machen.
In unserer Phantasie erlebten wir dann die schrecklichsten
Sachen, wenn wir auf eingefallene Minengänge und
Kaninchenknochen stießen. Besonders groß
war die Erregung, als uns einmal die Streichhölzer
fehlten, um die ausgegangene Laterne wieder anzuzünden.
Mein Vater beschäftigte
sich sehr viel mit mir. Oft machten wir Ausflüge
in den Taunus und rheinabwärts. Dann quälte
ich ihn, mir Geschichten aus den drei Feldzügen,
die er mitgemacht hatte, zu erzählen. Oder wir
besprachen meinen Wunsch, später auch einmal Soldat
zu werden. Ich entsinne mich noch sehr gut des Tages,
an dem ich gewissermaßen gegen die Tradition der
Familie beschloß, Kavallerist zu werden. Der Pferde
meines Vaters muss ich hier noch gedenken, ein
famoser eleganter Schimmel und mein alter Metzer Freund
„der Dicke“, eine Art Bierwagenpferd, auf
dem ich öfter meine Reitstudien machte. Beide standen
unter der Obhut meines immer hochgeehrten Freundes,
des Musketiers Leiting.
Ein großer Anziehungspunkt
für mich war der Kasinogarten am Binger Thor. Dort
versammelten sich fast jeden Sommernachmittag die angehenden
Damen und Herrn der Offiziersfamilien und da ich mich
schrecklich in die Tochter eines Hauptmanns –
eine kleine kühle Blonde – verliebte, vernachlässigte
ich sogar die strenge Arbeitsstunde, um mich im Minnedienst
zu üben.
Eine sehr nette Reise
(1894) machte meine Mutter mit mir, um die, ob der Faulheit
ihres Großneffen baß entsetzte Tante Vohs
im Spreewald und Fräulein Pothoff, die alte Erzieherin
meiner Mutter, in Rheinsberg an der märkischen
Saar zu besuchen.
Im Dezember 1894 verließen
wir das schöne Mainz, da mein Vater zum Oberst
und Kommandeur des 26. Regiments in Magdeburg ernannt
worden war. Gesundheitlich ging es mir nicht besser,
und auf dem Gymnasium machte ich gänzlich fiasco.
Ich war noch dazu in das schöne Alter gewachsen,
das man die Flegeljahre nennt und muss sagen, dass
ich mit meinem Freunde Max Lenné zusammen es
den Lehrern wohl schwer machte. Andererseits begegnete
ich aber auch einer Pedanterie und Rücksichtslosigkeit,
die erstaunlich war.
Doch an Freude außerhalb
des Schulbereiches fehlte es wieder nicht. Mit Walter
von Geldern zusammen bekam ich auf dem Schimmel meinen
ersten Reitunterricht und erregte die große Zufriedenheit
meines Train-Sergeanten, der aber, wie ich jedermann
versicherte, früher mal Dragoner gewesen war. Auch
in der Turnhalle erwies ich mich brauchbar, was allerdings
damit endete, dass ich mir ein Bein brach.
Obwohl ich nun anfing,
ein wenig älter zu werden und als erster die Würde
der langen Hosen und Konfirmandenunterricht bekam, hörte
ich nicht auf, mit Bleisoldaten zu spielen. Im Gegenteil,
zu jeder Schlacht, die geliefert wurde, zeichnete ich
mehrere Pläne. Die Sache begann einem Kriegsspiel,
wie es im Offizierkorps gespielt wurde, ähnlich
zu werden.
Ein recht schmerzhaftes
und die Flegeljahre charakterisierendes Zwischenspiel,
das ich damals natürlich sehr ernst nahm, zeichnete
den Magdeburger Aufenthalt aus. Bei einer Harzpartie
verliebte ich mich in Julia, die Tochter eines Magdeburger
Offiziers dermaßen, dass ich mich aufs Dichten
verlegte. Doch ganz so schlimm kann es wohl nicht gewesen
sein, denn wenn mich das nötige poetische Empfinden
im Stiche ließ, wandte ich mich stets vertrauensvoll
an meinen Freund Erich Clemens. Eines Abends kurz nach
dem Geburtstage meiner Mutter gaben meine Eltern einen
Ball, zu dem auch die Eltern der angebetenen Julia zugesagt
hatten. Diesen Abend benutzte ich, band alle Geburtstagssträuße
der Frau Mama in ein Riesenbouquet zusammen, bewaffnete
mich mit einem Marzipan-Herz, revidierte mit Erich das
letzte Gedicht, schrieb es fein säuberlich ab und
klingelte bei Julia. Sie öffnete selbst und meine
Überraschung war so ungeheuer, dass ich ihr
nur das dreifache Geschenk in die Hand drückte,
um mit hochrotem Kopf sofort zu verschwinden. Dieses
Unternehmen blieb jedoch nicht unbemerkt. Julias ältere
Schwester deklamierte mein schönes Lied in einer
Gesellschaft von 100 Personen, so dass sich die
Leute vor Lachen schüttelten und Julia, die in
der Schule während des Unterrichts mit meinem poetischen
Erguß renommierte, musste eine Stunde nachsitzen.
In diese Zeit fällt
ein Ereignis, dass mir begreiflicherweise außerordentlich
nahe ging. Mein Vater, in dem ich stets das Ideal eines
tüchtigen Offiziers gesehen hatte, und der, wie
mir oft von Freunden erzählt wurde, auch als Mensch
von seinen Untergebenen so ungeheuer geschätzt
wurde, erhielt vielleicht gerade aus letzterem Grund,
den blauen Brief. Im April 1896 nach meiner Konfirmation
siedelten wir daher nach Blankenburg am Harz über.
Blankenburg ist ein sehr
nettes am Rand des Harz gelegenes Städtchen, reich
an Naturschönheit. Durch eine Ausfahrt hatte ich
es bereits von Magdeburg aus kennengelernt. Meine Eltern
kauften ein ganz hübsches alleinstehendes Haus,
bei dem ein recht netter Garten angelegt wurde. Das
Nachbarhaus kaufte ein Herr Lüders, mit dessen
Familie wir in näheren Verkehr traten. Mein Schulfreund
war Erich Stinderin, dessen Verwandte Hahns in Röderhof
am Harz wir oft besuchten und uns dann im Kreise trunkfester
Männer häufig des Guten zuviel taten. Turnerisch
waren wir beide auch sehr eifrig. Mein Tagebuch berichtet
über den 5. August 96: “Ich springe jetzt
1,60 m mit drei Schritt Anlauf und 1,20 m Schlußsprung.“
Das ist allerdings eine Leistung, die auch erwachsene
Turner nur selten erreichen.
Etwas anderer Art ist
der Bericht von Sonntag, den 8. November 1896: „In
der Nacht wachte ich durch furchtbaren Spektakel auf.
Als ich endlich wieder einschlief, kam Papa um 8 Uhr
zu mir und erzählte, dass ich eine Schwester
bekommen hätte, worauf ich ihn furchtbar auslachte.
Endlich musste ich es aber glauben“.
Meine Freude hierüber
war nicht allzu groß: „Mama und der Kleinen,
die Hildegard heißen soll, geht es sehr gut.“
Zwei Tage später: „Meine kleine Schwester
ist 49 cm groß (der kleine Finger nur 2 ½).
Vorläufig liegt sie in einem Waschkorb und niest
sehr viel, wobei sie sich immer rumdreht. Papa nennt
sie nur Thusnelde.“ Ein ereignisreicher Tag war
die Taufe Thusneldens. Ich selbst stand natürlich
im Konfirmationsanzug als Pate da. Dann hieß es
von neuem alle Kraft zusammen nehmen und eine Dame zu
Tisch führen.
Schmerzlich vermißte
ich die Pferde. Ein kleiner Ausgleich war da für
mich die Schönheit des Harzes, die ich gebührend
zu Fuß und per Rad ausnutzte. Sehr nett war eine
4-tägige Radfahrt um den Harz mit einem Kyffhäuserbesuch.
Auch nach Leipzig radelte ich einmal und besuchte die
Klasings.
Die Gymnasiastenzeit wurde
mir durch meinen Eintritt in den Schülerturnverein
sehr versüßt. Da wurde stets stramm geturnt,
bei allen offiziellen Gelegenheiten erschienen wir stolz
in Uniform. Einmal im Jahre erlebte man dann das öffentliche
Schauturnen mit dem darauffolgenden Ball.
Im Sommer 1897 spazierte
ich auch in die Tanzstunde. Wir waren einige 20 Gymnasiasten
und ebenso viele muntere Blankenburger Bürgermädchen.
Natürlich fand ein jeder seine Dame, der er seine
Dienste weihte. Herrlich war der Schlussball. Nachdem
man sich ordentlich ausgetanzt hatte, sollte gegessen
und dazu Wein getrunken werden. Das Essen ließ
lange auf sich warten, aber der Wein, den so manches
Dämchen vielleicht kaum einmal getrunken hatte,
war zur Stelle und tat seine große Wirkung. Das
war für mich der Tag des ersten Kusses und in meinem
Tagebuch erklärte ich ihn für den schönsten
meines Lebens. Diese Tanzfeste wurden später mit
Harzpartien verbunden und dauerten noch zwei Jahre weiter.
Hierbei freundete ich mich auch mit Curt Thesing und
Wolf Behrens an, zwei selten begabten jungen Leuten.
Im März 98 bestand
ich das Einjährigen-Examen. Der Sommer desselben
Jahres brachte eine urfidele Zeit für mich, besonders
durch meine Tennisliebe Fritzchen. Fritz Lüders
(der als Fähnrich a. D. berechtigt war, sich „Hochwohlgeboren“
zu schreiben und in der Mobilmachungsliste als Offizier
geführt wurde), Hans Lüders, Erna und Frieda
sahen uns durch einen abschüssigen Bauplatz mit
zahlreichen Maulwurfshaufen veranlaßt, einen Tennisklub
zu gründen. Frieda oder Fritzchen, unter diesem
Namen kannte man die forsche Majorstochter besser, war
die Seele des Ganzen und hatte uns so im Schlepptau,
dass unsere Herrn Eltern häufig mißbilligend
den Kopf schüttelten.
Eins unserer schönen
Tennisspiele wurde sehr gestört durch das plötzliche
Erscheinen meines Bruders, der, wie es hieß, in
Berlin studierte. Ich sah ihn unser Haus betreten und
eilte sofort dorthin und ließ meinen Vater holen.
Kaum hatte ich mich nach dessen Eintreffen wieder entfernt,
als ich erfuhr, Eugen habe meinen Vater mit einem geladenen
Gewehr bedroht. Ich stürzte sofort mit einem Revolver
zum Hause und als ich sah, wie Eugen mit dem Stocke
gestikulierte, spannte ich den Revolver - in der Aufregung
ging mir der Schuß ins Blaue hinein los. Eugen
stürzte auf mich zu, wurde jedoch von Arbeitern,
die gerade vorübergingen festgenommen und der Polizei
übergeben. Was daraus wurde, habe ich nicht erfahren.
Es scheint sich so mancherlei herausgestellt zu haben,
denn mein Bruder wurde nie wieder für längere
Zeit in Deutschland gesehen.
Der Abschluß der
schönen Tenniszeit war geradezu romantisch. Fritzchen´s
Eltern zogen fort und ein Abschiedsrendezvous wurde
vereitelt. So stand ich denn sinnend mit meinem Intimus
Hans Lüders nachts vor dem dunklen Haus des Majors.
Schließlich entschloß ich mich, an Fritzchens
Schlafzimmerfenster, das im ersten Stock lag, zu klettern.
Und so ging es denn mit wahrer Todesverachtung an den
Nägeln des Spalierobstes in die Höhe. Ich
musste schnell klettern, denn die langen Nägel
bogen sich unter mir. Der gute Hans hatte sich als Sprungfedermatratze
ans Haus gestellt. Kaum hatte ich das ersehnte Balkonfenster
neben dem offenen Schlafstubenfenster des Vaters erreicht,
als Fritzchen auch schon (im tiefsten Negligé)
an das Fenster trat. Wir hatten uns wohl nie weniger
etwas Böses gedacht wie in diesem Augenblick des
Abschieds.
Es ging mir damals besser,
als ich es vertragen konnte. Ein unglaublich törichter
Gymnasiastenstreich machte meinem Schulleben ein Ende.
Mit einigen Genossen, darunter auch Hans Lüders,
brach ich eines Nachts im Gymnasium ein, um das Klassenbuch,
das gar nicht einmal schlecht über uns berichtete,
wegzunehmen. Man zeigte die Sache der Polizei an. Als
aber verkündet wurde, es träte nur Bestrafung
von Seiten der Schule ein, zeigte uns der Pensionsvater
eines der Mitschuldigen (auf Wunsch seiner Frau) an.
Es gelang uns aber wenigstens, einen von uns zu verheimlichen.
Wir andern wurden in milder Form von der Schule entfernt.
Man war nahe daran, uns diesen kindischen Streich zu
verzeihen, jedoch zu unserem Pech saß der Blankenburger
Seelsorger im Gericht.
So kam ich auf die Presse
Fischer in Berlin, um mit meiner minderwertigen Schulbildung
nach sechsmonatlichem fleißigen Arbeiten durch
das Primanerexamen zu fallen (1899). Schweren Herzens
entschloß sich mein Vater, ein Gnadengesuch um
Erlassung der Primareife - was damals allerdings etwas
sehr häufiges war – einzureichen. Es wurde
bewilligt. Beim Thüringischen Ulanen-Regiment Nr.
6 wurde ich dann als Fahnenjunker angenommen, nach dem
man mir noch einmal dringend geraten hatte, Garde-Infanterist
zu werden.
Unsere „Einbruchsgeschichte“
war inzwischen von einem Staatsanwalt aufgegriffen worden.
So kam es nun, dass wir Attentäter alle ganz
ernsthaft verhört wurden. Im Moabiter Kriminalgericht
wurde ich wegen des Klassenbuches verhört, an demselben
Tisch verhörte man gleichzeitig Leute wegen Totschlags.
Unser Kinderstreich wurde ernst genommen und wir armen
Kerle ganz gehörig geängstigt. Durch einen
Gnadenakt des Prinzregent von Braunschweig wurde das
gerichtliche Verfahren, das bei vielen Heiterkeit erregte,
eingestellt. Nun begann die Vorbereitung zum Fähnrichsexamen,
das ich im August 1899 bestand.
Trotz vielen Ochsens -
9 (!) Stunden täglich Unterricht und zudem noch
häusliche Arbeiten - verlebte ich doch eine ganz
schöne Zeit in Berlin. Ich wohnte in der Fremdenpension
der Frau von Beyer, einer Tante 2. Grades von mir. Dort
gingen viele Ausländer ein und aus, meist jedoch
Skandinavier und Amerikaner.
Mit einer sehr schönen,
blauäugigen Schwedin, Helga, freundete ich mich
sehr an. Im Winter gingen wir öfter zusammen ins
Opernhaus, manche schöne Sommernacht verbrachten
wir dagegen spazierengehenderweise im Tiergarten. Ich
besuchte sie auch viel in ihrem Zimmer, um ihrem wunderbaren
Klavierspiel zuzuhören. Das wurde mir jedoch sehr
bald von der ehrenwerten Tante, die mit Passion am Schlüsselloche
stand, verwehrt. Es half ihr aber nichts. Helga wohnte
im Nachbarzimmer von mir und meinem Freund Ralph Belknap,
einem jungen Amerikaner. Ich kletterte dann unbekümmert
um die Höhe von vier Stockwerken am Hause nachts
entlang, um mit Helga unvergeßliche Stunden zu
verleben.
Dies und mein Freund Ralph,
der wirklich ein ganz erstklassiger Mensch war, bewahrten
mich vor einem Versinken im Preßstumpfsinn oder
einem Bummelleben, wie es die meisten Pressiers führten.
Wenn Helga und ich uns auch nie abfassen ließen,
so zogen wir uns doch Frau von Beyers höchsten
Zorn zu und als ich nach mißglücktem Examen
auf die Presse Ulich übersiedelte, wechselte ich
auch die Pension. Der Zufall führte Helga, die
ebenfalls wechselte, in dasselbe Haus. Sie wohnte in
einer größeren Gesellschaft und ich eine
Treppe höher in einer kleinen Pension bei einer
fidelen Rechtsanwaltswitwe, einer Frau Berger. Es dauerte
auch garnicht lange, da kam aus eigenstem Antriebe mein
amerikanischer Freund in meine Pension. Eine sehr nette
Freundin Helgas (Til Wall) war ebenfalls dort und so
hatte ich für die kurze Zeit, die mir das bevorstehende
Examen ließ, die reizendste Geselligkeit. Im August
1899 wurde ich einberufen. Man wohnte zum Zweck der
Examina eine Woche lang recht vergnügt, wurde aber
tagsüber geistig ganz gehörig ausgequetscht.
Ich bestand glücklicherweise
und verließ Berlin, um mich nach kurzem Urlaub
in Hanau beim Thüringischen Ulanen-Regiment Nr.
6 zu melden. Das Regiment war noch im Manöver,
als ich mich am 18. September draußen am Cambrywald
beim Wachtkommandanten meldete.
Allmählich war ich
19 Jahre alt geworden, aber nicht nur im Aussehen sondern
auch im Wesen ein vollkommenes Kind geblieben. Als ich
das erste Mal stolzerfüllt in der schönen
Ulanenuniform über die Straße ging, riefen
mir zu meinem Entsetzen die Straßenkinder nach:
„Ui! Das ist ja noch ein Bub.“ Der über
mich ausgefertigte ärztliche Bericht lautete: Fahnenjunker
von Steuben, Sehschärfe 1/20, Gewicht 55 kg, Größe:
1,72 m, Brustweite 76 - 84 (also 10 cm zu gering).
Bald begann jedoch der
Ernst der Sache. Dreierlei nahm mich ganz gehörig
in Angriff. Der Dienst, das Kasino und eine Horde wenig
netter Fähnriche, die zum Teil auch sehr bald scheiterten.
Im Dienst ging es toll her. Ich wurde mit den Rekruten
zusammen ausgebildet und habe wohl dem letzten Jahrgange
angehört, dem eine dermaßen rüde Behandlung
zuteil wurde, wie sie heutzutage einfach ausgeschlossen
ist und auch damals nur in Eskadronen vorkam, in denen
sich der Rittmeister eben um nichts kümmerte. Ein
ganz einzigartiger Mensch war Leutnant Freiherr v. d.
Osten-Sacken, ein Rekrutenoffizier. Einen halben Kopf
kleiner als der kleinste Rekrut, unproportioniert und
etwas veralkoholisiert, letzteres hielt er übrigens
für kolossal forsch. Infolge seines Exterieurs
war er entsetzlich mißtrauisch, er könne
von irgend jemand nicht genügend respektiert werden.
In der ganzen 1. Schwadron waren Zustände, die
was die Behandlung der Untergebenen und den Verkehr
der Ulanen untereinander betrifft, an Bosheit jeder
Beschreibung spotteten. Der kleine Sacken hielt eigentlich
jeden Dienst mit gezogenem Säbel ab. Noch schlimmer
war mein Berittführer Sergeant Seese, bei diesem
äußerte sich die Bosheit in krankhafter Weise.
Er biß die Leute beim Reitunterricht durch die
Lederhosen, stach beim Turnen mit Nadeln und schlug
sie braun und blau. Das Merkwürdigste war, dass
sich keiner beschwerte, eine solche Gewalt übte
er über seine Rekruten aus.
Als Fahnenjunker wurde
ich natürlich nicht angefaßt, aber dafür
habe ich zum Beispiel solange in Kniebeuge stehen müssen,
bis ich umfiel, und oft habe ich mich, wenn ich nachts
aus dem Kasino nach Hause kam, hingesetzt, um auf Befehl
des Sergeanten 500 mal aufzuschreiben „Ich soll
aufpassen“.
Das Kasinoleben und manches
andere gebe ich am besten durch meinen Tagebuchbericht
wieder: „Unsere Offiziere sind fast ohne Ausnahme
intelligente Menschen, die jedoch an Dienst nicht mehr
tun, als der vorgesetzte Kommandeur angesetzt hat und
dies nur unvollkommen. Blasiert ist keiner, aber jegliches
bessere Streben scheint nicht vorhanden. Großartig
ist die Offenheit, mit der jeder sich gibt, wie er ist.
In der Unterhaltung zeigen sich die meisten schlimmer
als sie sind. Die Schweinerei ist oben auf und diejenigen,
welche Kadetten waren, leisten natürlich ganz besonderes.
Die Kameradschaft könnte besser sein, doch am Rhein
soll es ja damit nicht so gut bestellt sein. Es kommt
hinzu, dass der Offizierersatz im 6. Ulanen-Regiment
ein besonders ungleichmäßiger ist. Die Unteroffiziere,
meist aus Thüringen, sind wie stets bei der Kavallerie
sehr roh und vergeben sich leicht was vor den Leuten.
Die Unteroffiziere gängeln die Leute vielfach und
jeder krumme Zweijährige fühlt sich seinerseits
berufen, die Rekruten zu schlagen“.
Die ersten 6 Wochen, in
denen ich jeden Stalldienst mitzumachen hatte, waren
einfach furchtbar. Vor 4 Uhr aufgestanden und bis ¼
7 im Stall geputzt. Von 7 - 8 Inspektion, von 8 - 9
(eigentlich dienstfrei) gesattelt, von 9 - ¾
11 Reiten. Bis fast ½ 1 Stalldienst. Dann große
Reinigung und zum Frühstück ins Kasino geeilt,
von ½ 2 - 2 Tränken der Pferde, von 2 -
½ 5 Fußdienst. Um 7 Uhr hatte ich in tadelloser
Verfassung - bei den von Pferdejauche und Frost ruinierten
Händen war das nicht so einfach - im Kasino zum
Essen erscheinen. Durchschnittlich ging ich dann um
11 Uhr nach Haus. Ging mal etwas beim Fußdienst
schlecht, so wurden wir einfach in den tiefen Sand des
Reitplatzes geschickt und machten ½ - 1 Stunde
ohne Unterbrechung Laufschritt. Einmal mussten
wir im kompletten Anzug eine ganze Stunde lang durch
den Sand laufen und gleichzeitig Lanzendeckungen machen.
Eine andere Schinderei, die mir aber gewöhnlich
viel Spaß machte, war der Springgarten. Dann ging
es ohne Bügel und Zügel mit „Hüften
fest“ unter Hersagen des 2 ten Kriegsartikels
über die Hindernisse. Sehr ulkig war es, wenn dann
bei der Stelle „Mut bei allen Dienstobliegenheiten“
wir mit einem Angstschrei runtersausten. Dieser ganz
gute Witz hat jedoch manchen ins Lazarett gebracht.
Ein herrlicher Dienst
waren die Reitjagden, die ich sämtlich mitritt.
Prächtiges Gelände, bald ging es durch schöne
Wälder, bald über Felder und durch Sümpfe,
bald über schöne Wiesen mit breiten Wassergräben.
Ein Bach war so breit, dass die meisten Pferde
nur mit den Vorderhufen das andere Ufer erreichten,
um dann klatschnaß nach sekundenlangem Ringen
glücklich weiterzugaloppieren. Oft ging es über
Chaussedämme und einmal 3 Meter steil bergab durch
fließendes Wasser und so weiter . Wenn ich dann
auf meinem „Titus“ dahingaloppierte, konnte
ich aufatmend Seese’s Galgengesicht vergessen.
Auch Herrn Leutnant v. Sacken, dessen Pferde sehr häufig
refüsierten. Die Pferde, die ich ritt, waren Volte,
Trenk, Brant und Baron. Der Baron war ein schneidiger
Gaul, der hervorragend sprang. Er ging aber leider oft
durch. So recht zum Kommißleben gehörte auch
meine Stube, in der stets eine wüste Unordnung
war und der Sand 1 cm hoch lag. Mein Putzer hatte ebenso
wenig Zeit wie ich. Das war aber nur in der ersten Schwadron
so.
Ganz anders war das Kasinoleben.
Oft war es sehr fidel, meist langweilig. Zwei schlimme
Sitten waren das Austrinkenmüssen, wenn einem zugeprostet
wurde und vor allen Dingen der Zwang, das Kasino als
Letzter zu verlassen. Die Fähnriche spielten eine
ganz untergeordnete Rolle. Jede Anrede hatte man als
Auszeichnung aufzufassen. Einige Herren waren jedoch
so liebenswürdig dafür zu sorgen, dass
ich wegen meines schlechten Magens geschont wurde.
Sehr nett waren die Liebesmähler.
Zum Beispiel die Weihnachtsfeier. Es waren sehr viele
Gäste da. Nach Verteilung ulkiger Geschenke - mir
schenkte der sehr nette Leutnant Schwartz ein Paar Gefreitenknöpfe
- wurde in animierter Stimmung die Tafel aufgehoben,
dann auch getanzt. Da ich mir im Bewußtsein des
Kommenden Mut angetrunken hatte, fiel ich oft hin und
wäre fast vom fürsorglichen Onkel Hans - Rittmeister
Nothmins - nach Hause gebracht worden. Danach wurde
aus dem Stehgreif „Faust“ aufgeführt.
Leutnant. von Querbeck, der Tonangebende und Hauptwitzbold
im Kasino - Mephisto. Leutnant Schwartz - Faust. Mein
Mitfahnenjunker, der gute dicke Gagern – Valentin.
Und ich - Gretchen. Als Zöpfe fungierten zwei Strohseile.
Hinter der Kulisse wurde
mit Gretchen so rumcharmiert, dass sich Mephisto
genötigt sah, einige Leutnants per Schwert rauszubefördern.
Wie ich dann gespielt habe, weiß ich nicht mehr
recht, aber die alten Herren hielten sich die Bäuche
vor Lachen und die jungen waren auf die Tische gestiegen,
um besser sehen zu können. Ich erinnere mich noch,
dass ich schwanger umherlaufen musste, dabei
meine Last, eine Bettdecke, verlor und ganz erschrocken
dabei stehen blieb, weil ich gar nicht wußte,
wo das Ding eigentlich herkam.
Gemein wurde Gagern einmal
behandelt. Er war zum Unteroffizier befördert worden.
Es wurde ihm ein Stiefel Sekt (1 Liter) überreicht
und er musste ihn leeren, ohne abzusetzen. Es folgten
noch sieben Flaschen Bier, jede auf einen Zug. Der arme
Kerl war natürlich viehisch besoffen, machte Radau,
wurde dienstlich festgenommen und ungnädig entlassen.
An Geselligkeiten machte
ich nur die großen Bälle mit, auf denen mir
natürlich nichts anderes übrig blieb, als
mich zu langweilen.
Am 1. März 1900 wurde
ich Unteroffizier und am 18. April Fähnrich. Zu
derselben Zeit verließ ich Hanau mit einem Seufzer
der Erleichterung und meldete mich in Danzig zum neunmonatigen
Kriegsschulkursus. Es war eine herrliche Zeit in Danzig.
90 gleichaltrige Kameraden mit den gleichen Interessen
und der gleichen Lebenslust. Dann Danzig selbst mit
seiner prachtvollen Umgebung und seinen Seebrücken!
Der Dienst, den man stets
mit dem größten Humor erledigte, teilte sich
in den Hörsaal und in den praktischen Dienst. Zu
acht hauste man in einer Stube. Es ist schwer zu sagen,
ob der
Radau am Tage oder des
Nachts größer war. Ein dauerndes Gekreische.
Manchmal wurde es toll und es kam vor, dass sich zwei
mit geschliffenen Rapieren in der Turnhalle gegenüber
traten, obwohl sie sich schon längst wieder vertragen
hatten. Ohne auch nur eine Ahnung vom Fechten zu haben,
prügelten sie dann auf einander los, bis nach Ansicht
eines Offiziers genügend Blut abgezapft war, während
die Sekundanten im Ordonnanzen-Anzug in dienstlicher
Haltung danebenstanden.
Unsere Vorgesetzten, besonders
der Kommandeur Oberstleutnant Freiherr von Baldenstein,
waren ganz besonders liebenswürdige Menschen und
gaben sich alle Mühe, uns das Leben leicht zu machen.
Eine würdige Ausnahme bildete allerdings mein Inspektionsoffizier,
ein Wurm, für den jeder Fähnrich ein Protz
war. Dieser eigenartige Herr meldete mich mal ohne weiteres
wegen Achtungsverletzung, so dass meine eben begonnene
Laufbahn bereits ins Schwanken geriet. Für unsere
Ausbildung wurde uns viel gezeigt. Wir sahen einen Teil
der Flotte, hierbei das kolossale Panzerschiff „Kaiser
Wilhelm II“, die Marienburg, die hochinteressanten
Panzerwerke von Thorn und Graudenz, das Schießen
der Küstenbatterien und der schweren Artillerie
bei Thorn.
Der Höhepunkt der
schönen Zeit war ein großes Sommerfest, das
wir zum Besten des Roten Creuzes gaben. Da gab es Quadrillen
und Voltigieren zu Pferd, Fahrschule, Ten de rose, Turnen
und eine große Landsknechtsaufführung. Da
ich von meinen Kameraden körperlich der gewandteste
war, hatte ich natürlich ordentlich mitzumischen
und mit hämischem Grinsen merkte ich, dass,
als ich man mich an meinem Geburtstage wegen Urlaubsüberschreitung
eingesperrt hatte, die Probe ohne mich schlecht zu bewerkstelligen
war (das Voltigieren gelang aber auch prachtvoll und
wurde im Zeitungsbericht, als einer Zirkusvorstellung
gleichwertig bezeichnet). Bei der Landsknechtsaufführung
spielte Fräulein von. B., eine sehr nette junge
Dame von auffallender Schönheit, als Germania die
Hauptrolle. Man kann sich wohl denken, wie die lieben
Fähnriche für ihre Germania schwärmten
und ich war nicht wenig stolz und glücklich, als
sie mir beim Tanzen ein Blatt aus ihrem Eichenkranze
schenkte.
Der Liebste unter den
vielen guten Kameraden war mir Moldzio von den 11. Dragonern.
Auch mit Plüzkow, dem Riesen, war ich viel zusammen
und eine urfidele Woche verlebte ich mit Westermann
und Friederici im Ostseebade Cranz.
Zum Regiment zurückzukehren,
hatte ich als das Examen nahte, wenig Lust. Da jedoch
meine Bemühungen fehlschlugen, zu einem anderen
Regimente, das mich auch annahm versetzt zu werden,
musste ich, nachdem ich das Offizierexamen bestanden
hatte, doch wieder in die verhaßte Kaserne am
Cambrywalde zurück.
Ich wurde aber sehr nett
in Hanau aufgenommen und am 18. Januar 1901, bei der
Feier des 200jährigen Bestehens Preußens,
zum Offizier befördert und sah so den sehnlichsten
Wunsch meiner Kinderzeit, mal Kavallerieoffizier zu
werden, erfüllt.
|
![]()
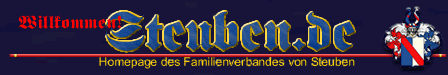
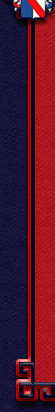
![]()